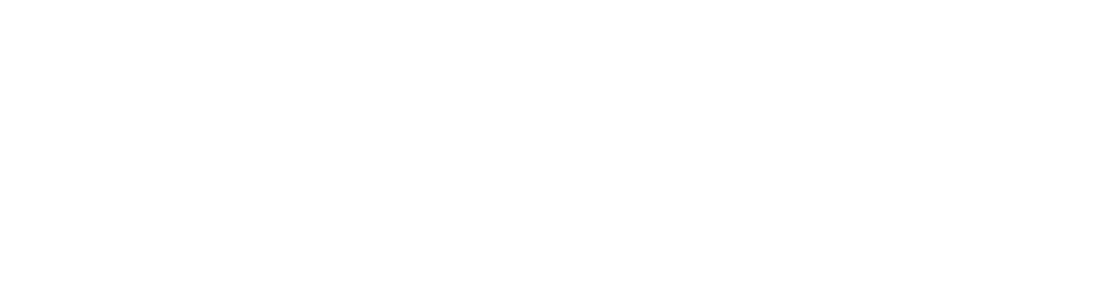Ein Leben frei von Sucht
Ein Interview mit Dr. Med. Unkelbach
Sucht ist kein Phänomen einer gewissen gesellschaftlichen Schicht, sondern kann Jung und Alt, Arm und Reich gleichermaßen treffen, auch Christen. Doch was ist Sucht aus medizinischer Sicht? Welche medizinischen Auswirkungen hat die Abhängigkeit? Ist Sucht vererbbar? Wie helfen Ärzte Suchterkrankten auf deren Weg aus der Abhängigkeit? Wir haben dazu den Klinikleiter und Chefarzt des Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide am Klinikum Oberberg, Herrn Dr. med. Bodo Unkelbach befragt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Suchterkrankung und einer Zwangserkrankung? Werden bei beiden Erkrankungen dieselben Areale des Gehirns angesprochen? Tatsächlich sind diese beiden Krankheitsbilder sehr unterschiedlich. Zwar ist ein Kriterium der Suchterkrankung, dass man ein fast zwanghaftes Verlangen nach dem Suchtmittel hat, dann hört es aber auch schon auf.
Süchtige wollen sich durch das Suchtmittel entlasten, sie suchen die Entgrenzung, das Schwerelose, einen weiten Horizont. Zwangserkrankte hingegen wollen ihre Ängste durch Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen kontrollieren. Durch Überstrukturierung ihres Alltags versuchen sie, unangenehme Gedanken zu vermeiden.
Wir haben sehr viele suchtkranke Menschen, die an Depressionen und Angststörungen leiden. Zwangserkrankte hingegen fürchten die Auflösung ihrer Grenzen, weshalb Suchtmittel nur selten für diese Gruppe attraktiv sind.
Diese beiden Krankheiten kann man auf hirnorganische Ebene nicht zufriedenstellend voneinander abgrenzen. Auch wenn wir schon eine Menge über das Gehirn wissen, verstehen wir noch zu wenig über die komplexen neurobiologischen Zusammenhänge, um damit tatsächlich einzelne Krankheitsbilder überzeugend zu erklären.
Verändert Sucht (dauerhaft) etwas im Gehirn?Ja. Ein Kernkriterium der Suchterkrankung ist der Kontrollverlust. Menschen trinken über Jahrzehnte Alkohol und können die Mengen kontrollieren. Irgendwann geht die Kontrolle verloren und sie trinken immer mehr, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen. Da findet eine hirnorganische Veränderung statt.
Immer, wenn man etwas lernt, verändert sich auch etwas im Gehirn. Eine Information wird gespeichert. Und mit dem Kontrollverlust verhält es sich wie mit dem Fahrradfahren. Wer einmal Fahrradfahren gelernt hat, verlernt es sein Leben lang nicht mehr. Auch wenn er zehn Jahre lang kein Fahrrad fährt und sich dann wieder draufsetzt, sind die ersten Meter etwas wackelig und dann läuft es wieder wie von allein.
Mit dem Kontrollverlust bei dem Suchtkranken verhält es sich genauso. Wer ihn einmal „erlernt“ hat, kriegt ihn leider sein Leben lang nicht mehr los. Deshalb ist die Empfehlung der Suchtmediziner immer eindeutig: Abstinenz!
Was geschieht im Gehirn: Gibt es Regionen des Hirns, die bei Süchtigen besonders aktiv sind? Beeinflussen diese Hirnaktivitäten das Verlangen?  Veränderungen im Gehirn finden vor allen Dingen auf der Ebene der Neurotransmitter und der Rezeptoren statt. Suchtmittel führen dazu, dass glücklich machende Transmitter wie Dopamin und Endorphine ausgeschüttet werden. Das ist ganz ähnlich einem Orgasmus, bei dem auch plötzlich glücklich machende Hormone, also Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Nur bei dem Suchtkranken werden diese im Übermaß ausgeschüttet, so dass in der Folge vermehrt Rezeptoren ausgebildet werden.
Veränderungen im Gehirn finden vor allen Dingen auf der Ebene der Neurotransmitter und der Rezeptoren statt. Suchtmittel führen dazu, dass glücklich machende Transmitter wie Dopamin und Endorphine ausgeschüttet werden. Das ist ganz ähnlich einem Orgasmus, bei dem auch plötzlich glücklich machende Hormone, also Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Nur bei dem Suchtkranken werden diese im Übermaß ausgeschüttet, so dass in der Folge vermehrt Rezeptoren ausgebildet werden.
Dadurch gerät das Gleichgewicht von Neurotransmittern und Rezeptoren aus dem Lot. Denn, um sich ausgeglichen zu fühlen, sollte etwa immer derselbe Prozentsatz an Rezeptoren mit diesen Neurotransmittern besetzt sein. Wenn aufgrund des Überangebotes der Neurotransmitter vermehrt Rezeptoren ausgebildet werden, führt das zu einem Defizit an besetzten Rezeptoren, wenn kein Suchtmittel eingenommen wird. Dann werden die Betroffenen unzufrieden.
Nur bei dauerhafter Abstinenz bilden sich die zu viel ausgebildeten Rezeptoren wieder zurück. Ein schwer abhängiger Mensch benötigt aber häufig durchaus bis zu sechs Monaten Suchtmittelfreiheit, um sich wieder ausgeglichen und „normal“ zu fühlen.
Gibt es hirnorganische/neurobiologische Faktoren, die zu einer Sucht führen?
Der zuvor beschriebene Mechanismus führt dazu, dass sich suchtkranke Menschen ohne Suchtmittel leer, hohl, einsam, ängstlich und depressiv fühlen. Es ist ihnen nicht möglich, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu freuen. Um dieses „Unlusterleben“ zu kompensieren, steigt ihr Verlangen nach Suchtmitteln. Damit schließt sich ein Teufelskreis.
Was gehört Ihrer Erfahrung nach zu den typischen Ursachen einer Sucht? Gibt es erbliche Faktoren, kann also Sucht genetisch veranlagt sein?
Man muss davon ausgehen, dass es bei Suchtkrankheiten wie bei jeder anderen Erkrankung genetische Faktoren gibt. Ein Beispiel: Nehmen sie fünf Männer, die 150 kg wiegen. Zwei entwickeln eine Zuckerkrankheit, drei tun es nicht. Hier spielt die genetische Veranlagung eine große Rolle. Bei Suchtkrankheiten verhält es sich ähnlich.

Wir haben in Deutschland viele Menschen, die aus suchtmedizinsicher Sicht zu viel trinken. Die meisten von ihnen merken das irgendwann, trinken dann weniger und die Sache hat sich erledigt.
Einige wenige kommen davon nicht mehr los. Viele junge Menschen haben Zeiten, in denen sie es beispielsweise mit dem Alkoholkonsum übertreiben. Die meisten denken sich irgendwann, dass das jetzt eine wilde Zeit war und dann legen sie den Schalter um und mäßigen sich. Manche haben aber Pech, bleiben an dem Suchtmittel kleben und kommen einfach nicht mehr davon los.
Gibt es Faktoren, die das Risiko süchtig zu werden, zusätzlich begünstigen, wie u.a. persönliche Umgebungsfaktoren, soziale Faktoren, der eigene Persönlichkeitstyp oder besondere Zeiten wie in der Corona-Pandemie oder Rezessionen?
Neben den biologischen Faktoren spielen natürlich auch psychosoziale Faktoren eine Rolle.
Bei den psychologischen Faktoren ist von Bedeutung, was ich in Kindheit und Jugend mit auf den Weg bekommen habe. Wenn ich ein lösungsorientierter Mensch bin, wenn ich Belastungen aushalten kann, wenn ich gelernt habe, mein Leben in die Hand zu nehmen und mein seelisches Befinden gut zu steuern, sind die Chancen gering, eine Suchtkrankheit zu erleben. Habe ich hingegen erfahren, dass jedes Problem fast unlösbar ist, ich sowieso nicht viel Wert bin und von der Gunst anderer abhängig bin, dann steigt die Gefahr stark an, einmal eine Suchterkrankung zu entwickeln.
Das soziale Umfeld trägt natürlich seinen Teil mit dazu bei. Hier ist von Bedeutung, was für Vorbilder ich in Kindheit und Jugend erlebt habe und in welchen Kreisen ich mich als Erwachsener bewege. Wenn alle Menschen um mich herum mäßig Alkohol trinken, werde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Wenn ich mich in Kreisen bewege, wo das regelmäßige Besäufnis am Wochenende dazu gehört, werde ich mich in meinem Verhalten wahrscheinlich auch anpassen.
Die Corona-Pandemie hat durch den Lock-down dazu geführt, dass einsame Menschen noch einsamer werden und dass in Familien, die konfliktbeladen sind, die Konflikte noch unerträglicher werden. Das kann natürlich zu einem erhöhten Alkoholkonsum führen.
Nehmen Suchterkrankungen in unserer Gesellschaft, insbesondere in Krisenzeiten oder auch aktuell infolge der Corona-Pandemie Ihrer Einschätzung nach zu?
Die tatsächlichen Auswirkungen von Krisensituationen lassen sich nur schwer abschätzen. Die Corona-Pandemie ist insbesondere für solche Menschen gefährlich, die ohnehin kritischen Suchtmittelkonsum betreiben. Grundsätzlich bedarf es aber in der Regel eher Jahre regelmäßigen Suchtmittelkonsums, bis sich eine Suchterkrankung ausbildet. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Sind Männer und Frauen, junge und ältere Menschen gleichermaßen von einer Sucht betroffen? Laut Drogen-und Suchtbericht 2019 sind es z.B. tendenziell eher Männer, die rauchen oder Alkohol trinken. Essstörungen, wie z.B. Magersucht oder Bulimie betreffen vielleicht eher jüngere Frauen. Gibt es gewisse Tendenzen innerhalb der verschiedenen Suchterkrankungen hinsichtlich des Geschlechts oder des Alters?
In unserer Suchtklinik sehen wir grundsätzlich mehr Männer als Frauen. Bei Alkoholabhängigkeit gehen wir von einem Verhältnis von 75 % Männern zu 25 % Frauen aus. Bei Tranquilizern wiederum soll es deutlich mehr Frauen geben, die betroffen sind. Bei illegalen Drogen haben wir auch wesentlich mehr Männer als Frauen in Behandlung. Hingegen überwiegt bei Depression und Angststörungen deutlich der Frauenanteil.
Was ist das typische Erkrankungsbild einer Suchterkrankung, anhand dessen erkennbar ist, ob eine psychische oder auch körperliche Abhängigkeit besteht?
Fangen wir mit dem einfachsten Kriterium an: Das ist erfüllt, wenn wir den Eindruck haben, dass jemand zu oft zu viel trinkt.
Ein weiteres Kriterium ist der Alkoholkonsum in unpassenden Situationen. Noch konkreter wird es, wenn zu Gunsten des Alkoholkonsums andere Interessen vernachlässigt werden, jemand zum Beispiel alkoholisiert Auto fährt, die Arbeit schleifen lässt oder lieber Alkohol trinkt, als sich um Freunde und Familie zu kümmern.
Morgendliches Trinken und Alkoholverstecke sind schon sehr klare Anzeichen. Erhöhte Reizbarkeit, wenn jemand leicht zu verunsichern ist, selbstunsicher wird, Frustrationen schlecht aushalten kann und zunehmend ängstlich wird, können in Zusammenhang mit regem Suchtmittelkonsum Hinweise auf eine Suchterkrankung sein.
An körperlichen Symptomen fallen insbesondere das Zittern, Schwitzen, hoher Blutdruck, rascher Puls und innere Unruhe auf.
Wer bemerkt die Sucht zuerst: Sind es nach Ihrer Erfahrung die Angehörigen oder Freunde, die z.B. Verhaltensoder Wesensänderungen feststellen und ärztlichen, seelsorgerlichen oder psychologischen Rat suchen – oder bemerken die von einer Sucht Betroffenen ihre Suchterkrankung selbst zuerst, wenn z.B. der Leidensdruck für sie zu groß wird oder sie bei körperlichen (Folge-)Erkrankungen eine ärztliche Behandlung benötigen?
Der Betroffene bemerkt in der Regel als Letzter, dass er ein Problem hat. Er lebt nach dem Motto: Ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne. In diesem Satz, der so flapsig klingt, steckt eine tiefe Wahrheit. Denn tatsächlich geht es dem Betroffenen mit seinem Suchtmittel gut. Nur, wenn jemand auf den Gedanken kommt, ihm das wegnehmen zu wollen, wird er nervös und reagiert gereizt. Da Suchtmittel sämtliche kritischen Fähigkeiten lahmlegen, merken die Betroffenen tatsächlich erst, dass sie ein Problem haben, wenn die Hütte brennt.

Oft kommen die Betroffenen dann zu uns, wenn ihnen in einem der vier großen Lebensbereiche die gelb-rote Karte gezeigt wird:
- Wenn der Ehepartner Druck macht und sagt, „du musst was verändern, sonst ziehe ich bald aus“.
- Wenn der Arbeitgeber sagt, so geht es nicht weiter, tu etwas, sonst fliegst du raus.
- Wenn der Magen oder die Leber sich zu Wort melden und signalisieren „Hilfe, wir können nicht mehr, tu‘ was!“
- Wenn der Führerschein verloren geht.
Es ist mutig und ein guter erster Schritt, wenn jemand von sich aus Hilfe sucht, um die Sucht zu bekämpfen und frei davon leben zu können. Was empfehlen Sie Betroffenen, die gegen Ihre Sucht angehen möchten: In welchen Fällen ist es für sie hilfreich, direkt einen Psychiater zu konsultieren?
 Das ausschlaggebende Kriterium ist immer die Abstinenz. Es gibt sicherlich Menschen, die von einer Beratung durch den Hausarzt oder durch eine Suchtberatungsstelle profitieren und dann den Suchtmittelkonsum bleiben lassen können. Sehr viele Menschen müssen jedoch aus ihrem Umfeld herausgenommen werden, um wirklich einmal Abstand zu gewinnen und um medizinische Betreuung für das Entzugssyndrom zu erhalten.
Das ausschlaggebende Kriterium ist immer die Abstinenz. Es gibt sicherlich Menschen, die von einer Beratung durch den Hausarzt oder durch eine Suchtberatungsstelle profitieren und dann den Suchtmittelkonsum bleiben lassen können. Sehr viele Menschen müssen jedoch aus ihrem Umfeld herausgenommen werden, um wirklich einmal Abstand zu gewinnen und um medizinische Betreuung für das Entzugssyndrom zu erhalten.
Keine Angst vor der Psychiatrie! Wir sind fast normale Krankenhäuser, unsere Patienten sind freiwillig bei uns und wir haben nur ein Ziel: Den Patienten wieder stark zu machen. Wenn man mit ambulanter Unterstützung keine Abstinenz schafft, dann sollte man nicht lange zögern und stationäre Hilfe in Anspruch nehmen. In aller Regel haben Kliniken Ambulanzen, in denen man sich informieren und orientieren kann.
Wie läuft die weitere Behandlung etwa ab? Lässt sich die Behandlung in
verschiedene Phasen gliedern? In welchen Fällen ist eine stationäre Therapie
ratsam/erforderlich?
In der stationären Behandlung unterscheiden wir zwischen der Entgiftungsbehandlung, der Motivationsphase und der Rehabilitationsphase.

Entgiftung
Zuerst muss das Suchtmittel raus, also eine körperliche Entgiftung, damit der Betroffene überhaupt die Möglichkeit hat, wieder klar zu denken.
Motivation
In einer zweiten Phase, die in jeder guten Psychiatrie angeboten wird, geht es darum, für sich eine Perspektive zu entwickeln und den Willen zur Abstinenz zu festigen.
Rehabilitation
Die dritte Phase erfolgt im Rahmen langfristig ambulanter Hilfen, zum Beispiel Suchtberatungsstellen und Selbsthilfegruppen oder auch stationär in einer Rehabilitationsklinik.
Bei der Sucht handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die man nicht mit einer kurzen Behandlung wegzaubern kann. Es geht darum, sich langfristig immer wieder mit der Suchterkrankung auseinanderzusetzen, weil die Gefahr an jeder Ecke lauert und ein Rückfall so furchtbar einfach passieren kann.
Ab wann kann man sagen, man hat es geschafft und ist frei von Sucht?
Der Ausdruck „ich habe es geschafft“ ist mir zu absolut. Am Ende eines Tages kann man sich auf die Schulter klopfen: „Ich habe den Tag heute wieder abstinent geschafft!“ Doch frei von der Krankheit wird man bis zu seinem Lebensende nicht.
Aber, diese lebensbedrohliche Erkrankung hat auch eine positive Seite: Man kann mit ihr symptomfrei leben. Das kann nur funktionieren, wenn man nicht versucht, einen Haken hinter die Sucht zu machen, sondern, wenn man sich mit ihr arrangiert und mit ihr lebt.
Dies funktioniert, wenn man sich von dem Gedanken befreit, dass die Suchtkrankheit von moralischer Minderwertigkeit zeugt. Nur, wenn man die Krankheit als Krankheit annehmen kann, kann man ein akzeptierendes Verhältnis zu ihr aufbauen.
(Wie) Kann aus Ihrer Sicht der christliche Glaube bei der Therapie und Genesung helfen?
 Wenn man an einen Gott glaubt, der es gut mit den Menschen meint und für jeden Einzelnen das Beste will, kann man daraus sehr viel Zuversicht schöpfen und für sich neue Ziele entwickeln. Gute Voraussetzungen habe ich, wenn ich glaube, dass Gott auch an mich glaubt, dass er mir die Abstinenz zutraut.
Wenn man an einen Gott glaubt, der es gut mit den Menschen meint und für jeden Einzelnen das Beste will, kann man daraus sehr viel Zuversicht schöpfen und für sich neue Ziele entwickeln. Gute Voraussetzungen habe ich, wenn ich glaube, dass Gott auch an mich glaubt, dass er mir die Abstinenz zutraut.
Glaubt man an einen Gott, für den die Moral wichtiger als der Mensch ist und bei dem eine Suchterkrankung als Charakterschwäche gilt, kann sich ein solcher Glaube eher zerstörerisch auswirken. Die Betroffenen haben ohnehin Schuldgefühle bis über beide Ohren. Wenn sie sich dann noch mit einem Gott konfrontieren, der moralisiert und bestraft, kann man nur noch Alkohol trinken, um das auszuhalten.
Wenn man sich in einer christlichen Gemeinde mit akzeptierender und wertschätzender Grundhaltung bewegt, kann das sehr viel Halt geben. Wichtig ist hierbei, dass die Eigenverantwortlichkeit des Betroffenen immer respektiert wird, dem Betroffenen Unterstützung und Hilfe angeboten wird, gleichzeitig aber auch signalisiert wird, dass der Betroffene den Weg mit Konsum alleine geht und die Brüder und Schwestern sich nicht dafür zuständig fühlen, die Folgen des Suchtmittelkonsums aufzufangen oder zu beseitigen.
Wie ermutigen Sie jemanden dazu, Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht aufzugeben und für ein Leben ohne Sucht und Abhängigkeit den Weg der Therapie zu gehen?
Zunächst ist es wichtig, zurückzuschauen und zu sehen, welche Kompetenzen und Ressourcen der Betroffene hat. Was hat er in seinen suchtmittelfreien Lebensabschnitten geschafft? Auch ist es wichtig, die Folgen des Suchtmittelkonsums klar zu benennen und sich vor Augen zu halten, ohne zu moralisieren.
Dann geht es um den Blick nach vorne. Es gibt die Alternative, weiter zu konsumieren und die vier wichtigen Lebensbereiche zu gefährden oder zu zerstören. Dann gibt es die Möglichkeit, wieder zurück ins Leben zu finden, wenn man abstinent ist. Die entscheidenden Fragen lauten: „Welchen Preis zahlst du für deine Sucht?“ Mit der Anmerkung, dass der Betroffene damit rechnen muss, dass der Preis mit jedem Rückfall höher wird.
Die zweite Frage ist die Frage: „Wie willst du leben?“ Man kann sich ganz verschiedene Lebensinhalte und –ziele vornehmen. Aber ganz egal, was man erreichen will, es wird nur ohne Suchtmittel gehen.
Dann ist die Frage: „Bist du bereit, auf das Suchtmittel zu verzichten, um deine Familie zusammenzuhalten, deine Arbeit zu behalten und gesund zu bleiben?“ Wenn wir unseren Patienten diese Fragen stellen, ist eine mögliche Antwort, dass der Patient sich dafür entscheidet, weiter zu trinken. Auch diese Entscheidung können wir nur akzeptieren, auch wenn wir sie persönlich sehr bedauern und ihn auf diesem Weg nicht begleiten werden.

Von entscheidender Bedeutung ist aber, dass der Betroffene die Entscheidung für sich fällt. Es ist unmöglich, sie ihm abzunehmen. Nur wenn der Betroffene sich entscheidet, den zunächst anstrengenden und steinigen Weg der Abstinenz zu gehen, wird er erfolgreich sein. Dieser Weg ist aber durchaus möglich, und es gibt viele Menschen, die ihn dabei unterstützen.
So ist das nun mal: Suchtmittel bringen kurzfristig Gewinn und langfristig zahlt man einen sehr hohen Preis. Bei der Abstinenz verhält es sich umgekehrt: kurzfristig ist sie sehr anstrengend, unangenehm und manchmal auch sogar quälend, langfristig ist sie ein enormer Gewinn. Sie führt zurück in das wahre Leben.
Herzlichen Dank für das Interview!
***

Dr. med. Bodo Karsten Unkelbach, Klinikdirektor/ Chefarzt, Zentrum für Seelische Gesundheit Marienheide, Klinikum Oberberg
Der verheiratete Christ und zweifache Vater Bodo Karsten Unkelbach hat u.a. auch zwei hilfreiche Bücher geschrieben, die im Claudius Verlag veröffentlicht wurden und im Buchhandel erhältlich sind:


Freundschaft und Selbstliebe sind hervorragende Antworten auf Suchtkrankheiten. Sie bieten das, wonach sich Suchtkranke erfahrungsgemäß häufig sehnen.
Sehen Sie sich auch die ermutigen Geschichten von Menschen an, die mit Gottes Hilfe frei von Sucht wurden: Ein erfülltes Leben frei von Sucht
Mehr spannende Artikel zum Thema finden Sie im ERLEBT Magazin